Neu von RJ Scott: Ein Weihnachtswunder
Für Zachary Weston bedeutet Weihnachten, dass er auf einer Bank auf dem Kirchhof bei Eis und Schnee schläft, ohne Aussicht auf Besserung seiner Situation: Aus dem Haus geworfen, weil er schwul ist, hat er kein Geld und, wie es aussieht, auch keinen Platz, wo er hingehen könnte. Erst ein Fremder zeigt ihm, dass es doch noch Menschen gibt, die mehr als Verachtung für ihn übrig haben.
Ben Hamilton ist ein frisch gebackener Polizist in seiner kleinen Heimatstadt. Er findet einen Ausreißer aus der Großstadt, der an einem verschneiten Heiligabend auf einer Friedhofsbank schläft. Kann er derjenige sein, der Zachary sein eigenes Weihnachtswunder schenkt?
Übersetzung: Chris McHart
Links kaufen
Amazon (DE) | Amazon (US) | Amazon (UK) | Kobo | Barnes & Noble | iTunes
Auszug
Erstes Kapitel
Das erste Weihnachten
«Hey, du kannst hier nicht schlafen.»
Zachary Weston hatte seine Augen geschlossen und begann, sich vom Schlaf übermannen zu lassen. Die absolute Erschöpfung bedeutete, dass er nicht mehr länger wach bleiben konnte. Der Schlaf kam schnell — der Schlaf eines todmüden Mannes — trotz der höllischen Schmerzen in seinem unteren Rücken. Er hatte sich die ganze Woche durchboxen müssen, durch den Schmerz. Ironischerweise halfen das Eis und die kalten Temperaturen gegen den Schmerz, auch wenn seine Arme und Beine dadurch froren.
Er sah es vor seinem inneren Auge: ein knackendes Feuer hinter einem eisernen Gitter, rotgoldene Flammen, die ein wunderschönes Licht durch den weihnachtlich dekorierten Raum warfen. Ein großer Baum stand in der gegenüberliegen Ecke; seine glitzernden Lichter, sein farbiger Schmuck und seine Kugeln glänzten und blitzten in vielen Farben.
«Hey, du kannst hier nicht schlafen.»
Viele Geschenke waren aufgestapelt, oder lagen planlos und gedankenlos arrangiert herum. Bücher, CDs und warme Kleidung waren in Papier eingewickelt, mit silbernen und goldenen Schleifen verschnürt. Sein Name stand in Gold auf einem Gutteil von ihnen.
«Hey, du kannst hier nicht schlafen.»
Draußen vor dem Fenster schneite es —kein Schneesturm, sondern weiche Flocken, die in einem hypnotisierenden Tanz fielen, um sich mit den weichen Konturen zu verbinden, die den wunderschönen Garten bereits vor den Blicken schützten. Die Kälte bedeutete, dass die Außenseiten der Fenster angefroren und mit weißen Linien überzogen waren, welche ungeordnete Gebilde über die Scheibe zogen und die bunten Lichter des Baumes reflektierten.
«Hey…»
Zach beugte sich nach unten, hob das erste Geschenk auf, und blickte seine Mutter an. Sie lachte ihm zu und, glücklich darüber, ihren Sohn so begeistert zu sehen, teilte sie ein verständnisvolles Nicken mit seinem Vater. Sie hatten beide so viel Liebe in ihren Augen.
«Hey!»
Jemand außerhalb des Raumes sprach mit ihm, aber er konnte nicht sehen, wer. Es war auch egal, denn wenn er sich stark genug konzentrierte, konnte er seine Aufmerksamkeit weiter auf die Geschenke richten. Er zitterte, die Kälte kroch in ihm hoch, und unbewusst bewegte er sich näher zum Feuer, runzelte aber die Stirn, als die Wärme eher verschwand. Dummes Feuer. Er nahm das nächste Geschenk, zog an dem rot-silbernen Papier und entdeckte das weichste Sweatshirt. Dick und warm und geschmeidig, in einem leuchtenden Blau, von dem seine Mama sagte, dass es zu seinen Augen passte. Trotz des Feuers war ihm immer noch so verdammt kalt, und so zog er es schnell über seinen Kopf. Die Wärme des weichen Materials war angenehm und beruhigend auf seiner eiskalten Haut. Er lächelte, weil er genauso von Wärme, Geborgenheit und der Festlichkeit eines Weihnachtsfests mit seiner Familie umgeben war wie von seinem Sweater.
«Du kannst nicht hier schlafen.»
Zach schreckte auf. Die Stimme von außerhalb des Raumes sprach plötzlich direkt an seinem Ohr, und die letzten Spuren seines Traumes waren nichts mehr als Gedanken in seinem Kopf. Abrupt öffnete er seine Augen und nach einer Sekunde fokussierten sie sich auf die Quelle der Worte. Zach sah sehr wenig, außer dem plötzlichen Schimmer einer silbernen Marke und der marineblauen Uniform, aber dann konzentrierte er sich auf die Augen des Sprechers. Sie erschienen hart im Straßenlicht, und sein Atem bildete kleine, weiße Wölkchen, die in der Luft schwebten. Scheiße! Jemand hatte ihn gesehen und gemeldet, oder der Polizist hatte ihn entdeckt. Er musste schon wieder verschwinden. Er zog an der dünnen Jacke, die in bedeckte, als eine Erinnerung an blaues weiches Material durch seinen Kopf schoss und ihn kurz verwirrte.
Zach hatte so gehofft, dem Gesetz entgehen zu können, hatte den Friedhof, vorsichtig optimistisch, als einen Zufluchtsort am Heiligen Abend gesehen.
«Entschuldigung», sagte er schnell und kletterte auf seine Füße so schnell er konnte. Auch wenn das nicht besonders schnell war, da es ihm vorkam als würde die Kälte seine Knochen zerbrechen. Er fluchte, als die Decke seinen tauben Fingern entglitt und im Schnee zu seinen Füßen landete. Das war die einzige Decke, die er besaß. Ein dünnes Stück Stoff, das er von Goodwill gestohlen hatte, als sich die Verkäuferin umgedreht hatte. Und jetzt wurde das verdammte Ding nass.
Aber darüber konnte er jetzt nicht weiter nachdenken; der Polizist wollte, dass er weiterzog. Er wollte sich nach unten beugen, um die Decke aufzuheben und bemerkte, wie sich der Boden in atemberaubender Geschwindigkeit näherte. Starke Arme stoppten ihn, bevor er mit dem Gesicht voraus im Schnee zu landete, aber er wand sich schnell aus ihnen heraus. Der Mann mochte ein Polizist sein, mochte eine Dienstmarke tragen, aber niemand berührte ihn. Zach wusste, was Männer von dem Kind, das er immer noch war, wollten. Er war nicht dumm, und er war genug von ihnen in der Stadt entkommen.
«Wie alt bist du?», fragte der Polizist. Er sah sehr besorgt aus.
«Achtzehn», log Zach schnell. Er trat einen Schritt zurück, bis seine Oberschenkel den Sitz der Bank, auf der er gelegen war, berührten. Der Polizist folgte ihm. Er sah angsteinflößend aus, obwohl er ein paar Zentimeter kleiner war als Zach. Er runzelte die Stirn.
«Wie alt bist du wirklich? Der Polizist gab nicht nach, sein Gesichtsausdruck ruhig, seine Stimme leise und neugierig.
Zach biss sich auf die Lippe, fühlte das heiße Blut an seiner Zunge. Die Kälte in ihm begann sich in einem Zittern zu zeigen, das sogar der Polizist sehen konnte. Vorsichtig hob Zach die feuchte und kalte Decke auf, versuchte eine Grenze zwischen sich und dem Polizisten mit dem harten Blick zu bilden.
«Siebzehn», sagte Zach schließlich, während er versuchte, das Klappern seiner Zähne zu stoppen. «Aber ich werde in ein paar Tagen achtzehn», setzte er hinzu, um dem Polizisten einen Ausweg zu geben. Er wollte hinzufügen: Lass mich in Ruhe, ich werde niemandem wehtun.
«Ben Hamilton», sagte der Polizist leise, und hielt seine Hand hin, als wollte er Zachs schütteln. Zach war verwirrt, erwartete das Glitzern der Handschellen, und unsicher vergrub er seine Hände tiefer in der nassen Decke, die er hielt. Der Polizist, dieser Ben Hamilton, bewegte seine Hand nicht, sondern hielt sie still und ruhig. Schließlich streckte Zach seine kalte Hand aus. Die Struktur der Lederhandschuhe des Polizisten fühlte sich weich und seltsam unter seinen Fingern an.
«Zach», stellte er sich leise vor, und dachte daran, seinen Nachnamen nicht zu erwähnen. Der Polizist fragte nicht nach, sondern nickte nur und zog seine Hand zurück.
«Also, Zach, was ist dir passiert? Warum liegst du auf einer Bank an der St. Margaret Church an Heiligabend?»
Der Polizist schrie nicht; er fragte ruhig, aber Zach ging trotzdem sofort in die Defensive. Im Blick des Polizisten lag Sorge und er kniff beim Fragen die Augen zusammen.
«Ich…» Zach überlegte, welche Lüge er erzählen könnte. Dachte an die Geschichten die er verwendet hatte, um die Leute davon zu überzeugen, ihn allein zu lassen. Nichts klang im Moment richtig. An diesem Polizisten war etwas anders, er war nicht viel älter als Zach, ein Polizist, der nicht aus der Großstadt kam, sondern aus einer Kleinstadt. Er war nicht Teil des Systems wie die Polizisten in der Stadt, die ihm gesagt hatten, er solle heimgehen. Aber ich habe kein Zuhause. … Vielleicht sollte er ihm die Wahrheit sagen?
«Ich kann im Moment nicht zu Hause sein», sagte er schließlich und zuckte, als die behandschuhte Hand des Polizisten die blauen Flecken über seinem linken Auge und herunter zu seinem Kiefer nachfuhr.
«Wer hat dir das angetan, Zach? Ist das hier, in dieser Stadt, passiert?» Die Worte des Polizisten luden ihn zu einem sicheren Platz ein, um ihm dort seine Geheimnisse mitzuteilen. Er war freundlich, hartnäckig und nicht sehr polizistenhaft. Zach schreckte sofort vor der sanften Berührung zurück. Eine eisige Klinge der Unsicherheit durchschnitt ihn, als er darüber nachdachte, dass er alleine mit diesem Mann, im Dunkeln, auf dem Friedhof, war. Er wirkte freundlich genug, aber was, wenn das auch wieder nur ein Akt war? Vorsichtig, um sein Vorhaben nicht preiszugeben, blickte er nach links und dann nach rechts. Wenn er versuchte, wegzurennen, brauchte er einen Vorsprung, und gehalten oder in die Ecke gedrängt werden, würde diesen Vorsprung zunichte machen. Zu seiner rechten blockierte dichtes Gestrüpp seinen Ausweg; auf der linken war das Tor zum Friedhof und die dunklen Grabsteine. Das war seine einzige Möglichkeit. Er verlagerte sein Gewicht auf den rechten Fuß, bereit loszurennen und das Tor zu überwinden. Sein Bein zitterte von dem zusätzlichen Gewicht, und er wusste, dass er vermutlich bei der ersten Hürde stolpern würde. Trotzdem, jeder Plan bot mehr Hoffnung als kein Plan.
«Ich bin hingefallen», sagte er bestimmt, den gleichen Satz, den er schon sein ganzes Leben lang benutzt hatte, den gleichen Satz, der ihm Blicke einbrachte, die von Mitleid bis Zweifel gingen. Wenn er diese Worte zu den Leuten von der Suppenküche, den Polizisten an der Ecke, den Besitzern des Obdachlosenwohnheims, gesagt hatte, hatte man ihn verflucht, angemacht, angeschrien, oder angeekelt weggeschickt. Er erwartete nicht viel von dieser Autoritätsperson.
«Uh oh.» der Polizist drängte nicht auf mehr Informationen, sondern nickte nur angesichts der einfachen Erklärung und trat einen Schritt zurück. Er sprach direkt in sein Walky Talky. «Ich gehe jetzt nach Hause. Es gab keinen Grund zur Beunruhigung an der Kirche.» Rauschen durchbrach die Ruhe der schneeschweren Luft, und eine dünne Stimme bestätigte seine Durchsage mit einer Reihe von Codes und einem einzigen Namen—Ben. Der Polizist blickte zurück zu Zach, und Zach wog ab, ob es jetzt, nachdem der Polizist zwei Schritte weg von ihm stand, einfacher sein würde, zum Tor zu kommen. «Du kannst hier nicht schlafen. Ich suche dir ein Zimmer für heute Nacht, und mit dem Rest setzen wir uns morgen auseinander.»
Zachs Augen weiteten sich. Er würde mit einem Fremden nirgendwohin gehen, zumindest nicht solange er nicht unter Arrest war. Dieser Polizist würde ihm ein Zimmer suchen? Vermutlich ein verschwiegenes Stundenhotel irgendwo. Scheiße. Das würde ihm nicht passieren. Er war vor zwei Nächten gerade so mit dem Leben davongekommen, als jemand versprochen hatte, ihm zu helfen. So leichtgläubig war er nicht mehr.
Er richtete sich zu seiner vollen Größe auf und seine Lippen verdünnten sich vor Entschlossenheit. Er würde nicht eine Hölle gegen die andere eintauschen, absolut nicht.
«Nein. Danke, aber nein, ich muss gehen … Ich muss zum Bahnhof, zum Zug.» Er versuchte, die Hoffnungslosigkeit aus seiner Stimme herauszuhalten, versuchte selbstsicher über das Klappern seiner Zähne hinweg zu klingen. Er sprach die Worte in seinem Kopf aus, und er wusste genau was er sagte. Es gab ganz sicher einen Grund dafür, dass er sich hier auf der Bank im Schnee am Weihnachtsabend befand und der Polizist sollte das respektieren. Dies war ein freies Land.
«Okay, Zach.» Der Polizist seufzte. «Wir können das auf zwei Arten machen: Es ist spät und es ist die Nacht vor Weihnachten. Ich möchte wirklich nach Hause gehen, um bei meiner Familie zu sein, und du machst das alles ziemlich kompliziert. Du kannst jetzt mit mir kommen, bekommst ein vernünftiges Essen, eine Dusche und vielleicht wärmere Klamotten, und dann kannst du die Nacht in einem warmen Bett schlafen. Das alles kann deine eigene Entscheidung sein, oder ich kann es offiziell machen und dich verhaften, und dich dann zwingen mitzugehen.»
Zach hörte jedes Wort. Er sah sich verzweifelt um, zu der kleinen Kirche, dem Friedhof, der Bank, dem Schnee, und dann zurück zu dem wirklich jung aussehenden Polizisten vor sich. Er war so am Arsch.
Das Eis unter seinen Füßen war seine langen Beine hinaufgeklettert und brachte Schmerzen mit sich. Die Kraft in seinen Beinen ließ nach. Er war schon so viele Tage davon gerannt, hatte es geschafft, immer einen Vorsprung zu haben. Vor allem und jedem, und er hatte nur noch zwei Tage bis er aufhören konnte, weg zu rennen. Warum musste sein Körper jetzt aufgeben?
«Also», fuhr der Polizist fort, «ich habe nicht die ganze Nacht Zeit. Ich möchte wirklich meinen Weihnachtstag nicht damit verbringen, neben deinem gefrorenen Körper zu stehen und dem Gerichtsmediziner deinen Tod zu erklären. Also wie ist deine Entscheidung…?»
Er hatte keine Wahl. Die Situation war ausweglos. Er wusste es, und der Polizist wusste es auch. Er richtete sich so gerade wie möglich auf, das Brennen in seinem unteren Rücken zurück auf seinem normalen Level, obwohl die Kälte der Bank es ein bisschen betäubt hatte.
«Okay», sagte Zach leise. Immerhin war dies ein Polizist. Wie konnte es falsch sein, es wenigstens für eine Nacht warm haben zu wollen? «Aber nicht in einer Zelle?», fragte er vorsichtig.
Officer Hamilton drehte sich um und trat von der Bank weg. «Nein, keine Zelle.»
«Versprechen Sie es?» Verdammt. Konnte er noch mehr wie ein Kind klingen? Das war nicht der beste Weg, wie ein verantwortungsvoller Erwachsener zu klingen, der Kontrolle über sein Leben hatte.
Der Polizist stoppte und blickte sich zu ihm um, während er die Hände in die Taschen seiner dicken Jacke schob. Zach spürte, wie er ihn darum beneidete.
«Ich verspreche es.» Er drehte sich um und erwartete deutlich, dass Zach ihm folgte, was der auch tat. Er stolperte über den eisigen Weg, in den selben dünnen Turnschuhen, in denen er vor einer Woche von zu Hause rausgeschmissen worden war. Er fluchte leise, weil die Schuhe des Polizisten diesem guten Halt gaben und ihn zwangen, hinterher zu hasten. Es war peinlich, wie ein verlorener Welpe hinter ihm her zu stolpern. Gleichzeitig musste Zach sich eingestehen, dass er vor diesem Polizisten nicht wegrennen könnte, selbst wenn er sich dafür entscheiden sollte, von dem Mann in Uniform weg zu kommen. Also folgte er so gut er konnte.
Schweigend liefen sie für etwas mehr als zehn Minuten durch die kalten, leeren Straßen. Vorbei an einem Marktplatz und an einer Uhr, die in die Wand einer kleinen Bibliothek eingebaut war. Die Uhr zeigte ihm, dass es 23:30 Uhr war. Der Polizist stoppte an dem kleinen Lebensmittelgeschäft mit dem Geschlossen Schild im Eingang, kontrollierte die Tür und blickte in das verlassene Innere. Zach beobachtete ihn bei der Arbeit, während er mit seinem Turnschuh gegen einen Haufen Eis auf dem Gehsteig trat. Danach führte der Polizist Zach in Richtung eines Gebäudes am Ende einer Reihe lauter gleich aussehender Häuser. Die Vorhänge waren noch geöffnet, und Zach konnte einen Baum am Fenster stehen sehen. Seine Lichter hießen sie willkommen, als sie den geräumten Weg entlang stiefelten. Officer Hamilton sperrte die Tür auf, klopfte den Schnee von seinen Schuhen, und signalisierte Zach, dass er ihm folgen sollte.
Zach zögerte. Er konnte die Wärme im Inneren fühlen, die weichen Lichter sehen, die Einfachheit eines für Weihnachten hergerichteten Hauses. Trotzdem, dieser Polizist bedeutete ihm, mit ihm in ein Haus zu gehen. Niemand würde wissen, dass Zach in dieses Haus gegangen war. Mit dem Polizisten. Mit einem Fremden.
«Ben?» Die Stimme war sanft, und eine Frau trat aus dem hell erleuchteten Flur und stoppte neben dem Polizisten. Sie war klein, wirkte gepflegt und machte einen besorgten Eindruck. Sie erinnerte ihnen an seine Mutter. Aber ohne den geschlagenen, erschöpften Blick, den sie immer zu tragen schien. «Was ist passiert?» Der Polizist zog seine Jacke aus und hing sie an einen Haken. Nahm seine Handschuhe ab und zog die schweren Schuhe aus.
«Wir haben einen Gast zu Weihnachten, Mom», sagte er sanft und bedeutete Zach, dass dieser durch die Tür treten sollte. Wie in einem Traum, zum Teil durch die Stimme in Sicherheit gewiegt, trat Zach über die Schwelle. Die Wärme an seiner eiskalten Haut war prickelnd heiß und schmerzhaft und er schloss die Augen angesichts der plötzlichen Veränderung in seinem Körper. Ein kurzer Moment der Angst machte sich in seinem Magen breit. Er war seit einer Woche nicht mehr hinter verschlossenen Türen gewesen, und es fühlte sich schneller wie ein Gefängnis, an als man gemütliches Zuhause sagen konnte.
Der Polizist—Ben—brachte ihn in ein Nebenzimmer, in dem ein Feuer im Kamin brannte, der Baum am Fenster stand und Geschenke verstreut vor ihm auf dem Boden lagen. Zach erhaschte den ersten richtigen Blick auf den Mann, der ihn vom Friedhof aufgelesen hatte. Er war ein bisschen kleiner als Zach. Kräftig und muskulös gebaut, mit dunklem Haar und nussbraunen Augen. Seine Uniform stand ihm gut, sie passte ihm sogar perfekt. Zach hasste Uniformen. Aber dieser Polizist sah nicht so offiziell aus wie die Wachleute im Park oder den Hauseingängen, in denen er geschlafen hatte. Er sah nicht gehetzt oder zweifelnd oder hart aus. Es machte Zach nervös, mit diesem Widerspruch in seinem Kopf konfrontiert zu werden.
«Das ist Zach. Er braucht Klamotten und einen Platz zum Schlafen für heute Nacht.» Bens Stimme war tief und bestimmt. Er lieferte keine Ausreden dafür, dass er einen Fremden in das Haus seiner Mutter gebracht hatte, und im Gegenzug schien sie auch nicht verärgert zu sein. Was für eine Art von Stepford Soap-Opera war das?
«Hallo, Zach.» Er zuckte angesichts der sanften Worte dieser Frau zusammen. «Geh dich waschen und ich mache dir Suppe warm.» Sie wartete nicht auf sein ja oder nein. Mittlerweile jedoch war der Gedanke an ein sauberes Badezimmer, eine Toilette und vielleicht eine Dusche genug um Zach in Tränen ausbrechen zu lassen. «Ben, zeige Zach das Badezimmer, gib ihm einen Rasierer und Handtücher und vielleicht kannst du ein paar Jogginghosen herauskramen, Liebling.» Sie lächelte ihn an, aber Zach war verwirrt, erschöpft, und hatte Schmerzen. Alles, was er tun konnte, war, sich auf den Beinen zu halten; Sprechen oder Antworten überstieg seine Fähigkeiten.
Die nächste Stunde war ein Nebel von Wärme und Wasser in der Dusche, die Tür verschlossen gegen jeden, der versuchen sollte, hereinzukommen. Der Rasierer schabte die dünnen, wuchernden Bartstoppeln weg. Er hatte seit einer Woche keine Zahnbürste mehr benutzt, und die neue Zahnbürste und Zahncreme säuberten seine Zähne, während er in den kleinen, beschlagenen Spiegel über dem Waschbecken starrte. Zach fühlte sich endlich sauber, das erste Mal seit über einer Woche.
Das letzte Mal, dass er die Chance gehabt hatte, sich zu waschen, war vor zwei Tagen gewesen, im Warteraum der Busstation, aber das Wasser im Becken war verdächtig braun gewesen. Er hatte ein Ticket in der Tasche gehabt, das ihn aus der Stadt bringen würde, so weit, wie ihn 18 Dollar und 20 Cent bringen würden. Zu seiner eigenen Sicherheit musste er aus Harrisonburg verschwinden. Nur Gott wusste, wohin ihn sein Weg führen würde, aber als er mit dem Finger entlang der Interstate 81 auf der großen Karte gefahren war, hatte er gehofft, er würde es bis Winchester schaffen. Dort lebten seine Großcousins, vielleicht würden die ihn bis Neujahr aufnehmen.
Die Assistentin hinter dem Glas hatte nicht direkt gelacht. Sie hatte aber, in dieser gelangweilten Art, wie sie nur Erwachsene, die Tickets verkauften, haben konnten, klar gemacht, dass er sich glücklich schätzen konnte, wenn er die Hälfte der Strecke schaffte. Er hatte genommen, was er konnte. War in Gott-weiß-wo gelandet, auf halbem Weg in die Sicherheit.
Selbstkritisch starrte er sich in dem Ganzkörperspiegel, der an der Rückseite der Badezimmertür hing, an. Sein Körper grenzte schon immer an «zu dünn», weil er so schnell wuchs, aber jetzt sah er nur noch verhärmt aus. Seine müden Augen und die gräuliche Haut betonten seine Schlankheit noch mehr. Zumindest waren seine Haare sauber, das Blond jetzt dunkler vom Wasser und aus den Augen gekämmt. Seine blauen Augen schienen aus seinem Gesicht hervorzuquellen. Sie waren blutunterlaufen und grau unterlegt, und die lila Flecken an seinen Augenhöhlen machten es nicht besser. Er sah erbärmlich aus. Er fühlte sich erbärmlich.
Der Polizist hatte ihm Jogginghosen dagelassen, die ein bisschen kurz für seine langen Beine waren, aber sie waren warm, trocken, und fühlten sich frisch gewaschen und weich auf seiner Haut an. Er zog das T-Shirt und dann ein Sweatshirt über sein handtuchtrockenes Haar und blickte schließlich wieder in den Spiegel. Die Tränen in seinen Augen waren unwillkommen. Zach sah sich selbst das erste Mal seit Tagen wirklich, nicht nur in einem Schaufenster. Er wusste, dass er viel Gewicht verloren hatte, er konnte es an seinen Jeans erkennen, die sich weigerten, ihm richtig zu passen. Im Spiegel sah er nur noch einen Schatten von sich selbst— geschlagen, erschöpft, und so verdammt dürr.
Er sah aus wie das typische Straßenkind. Es machte ihm Angst, dass er in so kurzer Zeit vom normalen Teenager, der mit dem Schulsystem kämpfte, zu dem gebrochenen Bild vor ihm geworden war.
Er wusste, dass er hinausgehen und dem Polizisten sowie dessen Mutter entgegentreten musste, denn er konnte sicher nicht für immer in diesem Badezimmer bleiben. Vorsichtig öffnete er die Badezimmertür; ein kleiner Teil von ihm erwartete den Polizisten, mit Handschellen vor der Tür stehend. Er war nicht da, aber das ließ Zach sich nicht besser fühlen. Er ging über den Gang und folgte den Stimmen in die Küche. Anscheinend hatten sie über ihn geredet, denn als er den Raum betrat herrschte sofort unangenehme Stille. Der Polizist saß am Tisch, eine Tasse in seinen Händen. Im hellen Licht der Küche sah er für einen Polizisten unglaublich jung aus. Seine — Bens — Mutter stand am Herd und rührte etwas in einem Topf. Ihre hellen, nussbraunen Augen wurden sanft, als sie ihn ansah und ihre Lippen bogen sich zu einem Lächeln. Er musste hier vorsichtig sein, seine Worte bemessen, nicht zu viel von sich preisgeben.
«Ist Hühnersuppe okay, Liebling?», fragte sie ihn sanft, fast vorsichtig.
«Gott, ja», sagte Zach leise, zusammenzuckend angesichts seines Kontrollverlustes und der Realisation dessen, was er gesagt hatte. Er mochte sich von Gott abgewandt haben, da dieser ihn verlassen haben musste, weil er von seinem Vater geschlagen und abgelehnt wurde. Das bedeutete aber nicht, dass andere nicht gläubig waren. Er musste auf seinen Mund aufpassen. «Tschuldigung, Ma’am», platzte er schnell heraus. «Ich meinte, ja, ich hätte gerne etwas Suppe.»
Der Polizist schnaubte amüsiert und seine Mutter klopfte unsanft an dessen Schulter und ermahnte ihn für sein unpassendes Gelächter. Sie löffelte etwas, dass himmlisch roch, in eine Schüssel und wies Zach an, sich hinzusetzen. Dann fuhr sie fort ihn wie einen Habicht zu bewachen, während er aß. Er konnte sich nicht dazu bringen, sich darum zu kümmern, ob sie ihn beobachtete oder dass der Polizist sich nicht von seinem Platz bewegt hatte und ihn immer noch ansah. Tatsächlich saßen sie vermutlich beide da und verurteilten ihn dafür, wie er aussah und wo der Polizist ihn gefunden hatte.
«Ben, Liebling, bist du fertig mit deiner Schicht?»
«Ja, bis morgen.»
«Dann zieh deine Uniform aus. Es sind noch Klamotten vom letzten Wochenende von dir oben. Vielleicht kannst du mir und dem jungen Zach hier Gelegenheit geben, uns zu unterhalten.» Zach hob seinen Kopf ,als er das hörte, das Brot auf halbem Weg zu seinem Mund. Unterhalten. Scheiße. Das wäre sein Ende.
«Ich bin in zehn Minuten wieder da», sagte Ben klar und deutlich. Zach sah ihn an, die Warnung: leg’ dich nicht mit meiner Mamma an, stand klar im Gesicht des Polizisten. Zach nickte leicht, um zu zeigen, dass er die Nachricht verstanden hatte, und beobachtete wie der breitschultrige Mann die Küche verließ.
«Also, Zach, ich nehme an, du bist nicht freiwillig hier?» Sie fing unschuldig genug an, goss ihm eine weitere Portion Suppe in seine Schüssel und gab ihm noch Brot. Dabei beobachtete sie ihn aufmerksam. Er fragte sich, was sie dachte, wenn sie ihn anblickte und er schämte sich. Die alten und neuen blauen Flecken auf seinem Gesicht, halb bedeckt vom immer noch feuchten blonden Haar, das er nach vorne gekämmt hatte, um sie zu verdecken. Er wusste, dass er jünger aussah als fast achtzehn — er konnte sogar leicht für viel jünger gehalten werden. Zach bemerkte jedes einzelne kleine Gefühl in seinem Körper, die Wärme, den Frieden, die Stille, die Akzeptanz, aber das war im Moment alles so falsch. Er verdiente es nicht, und er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte.
«Nein, Ma’am», sagte er schließlich, und biss in sein Brot, das so knusprig war, dass Brösel in seine Suppe fielen, als er es aß. Wenn er den Mund voll mit Essen hatte, brauchte er vielleicht nicht zu antworten. Er hatte genug Predigten in seinem Leben gehört, um sie einfach ausblenden zu können.
«Ben sagt mir, das du fast achtzehn bis, aber dass er nichts außer deinem Vornamen weiß.»
Verdammt. Sein Nachname, sie wollte seinen Nachnamen wissen. Er vermutete, dass es jetzt unwichtig war, nachdem er nicht mehr nach Hause gehen würde. Es waren nur noch zwei Tage, bis er achtzehn wurde. Es war zu spät, als dass die Mutter des Polizisten seine Familie suchen konnte. Er schluckte, den Mund voll Brot und Suppe, und wischte sich mit dem Handrücken über das Gesicht. Die Frau beobachtete ihn und lächelte ihn aufmunternd an.
«Zachary Weston, Ma’am», bot er schließlich an. «Ich werde am 27. Dezember achtzehn.» Sie nickte gedankenverloren, und er aß schnell noch einen Löffel Suppe; die Hitze glitt seidig warm seinen Hals hinunter. Sie sprach nicht sofort, sondern blickte auf die Tasse zwischen ihren Händen, bevor sie die nächste Frage stellte.
«Kannst du mir sagen, warum du nicht zu Hause bei deiner Familie bist?» Sie zögerte und legte ihren Kopf zur Seite. «Vermutlich sollte ich nicht davon ausgehen, dass du eine Familie hast.»
«Nein, Ma’am, ich habe eine Familie. Eine Mutter, Vater, und eine Schwester. Sie —mein Vater — wollte mich nicht mehr im Haus haben.»
«Was hast du getan, um das zu verdienen? War es die falsche Gesellschaft? Drogen? Alkohol?»
Schmerz schoss durch ihn, angesichts der Gründe, die sie ihm gab. Die Gründe, warum junge Menschen normalerweise obdachlos waren. Sie dachte, er wäre ein Junkie? Er hatte niemals auch nur eine Zigarette angefasst, gar nicht zu reden von Drogen, und was Alkohol anging … Er schloss einen Moment lang die Augen. Warum sollte sie auch denken, dass es nicht seine Schuld war? Er wusste, dass er krank genug aussah, um die Vermutung nahe zu legen, er sei auf etwas, das ihm schadete. Er wandte seinen Blick ab, als wäre er von der Suppe fasziniert, und sein Haar fiel nach vorne, um ihn vor ihrem scharfen Blick zu schützen. Sollte er ihr die ganze Geschichte erzählen? Würde sie die ganzen Details wirklich wissen wollen? Andere Leute hatten zwar gefragt, aber sie wollten es eigentlich gar nicht hören.
Sollte er ihr die Details über den strengen Ex-Militär, seinen Vater, geben, der der Meinung war, dass Lektionen am besten durch körperliche Züchtigung gelernt wurden? Oder sollte er ihr von Zuhause erzählen, und davon, dass er keine Freunde hatte? Vielleicht sollte er einfach den einfachsten Weg wählen, die Wahrheit, was ihm passiert war. Er wollte sie nicht anlügen. Es war nicht in ihm, zu lügen. Er blickte auf, und sah sie direkt an, die Suppe schwappte unruhig in seinem Bauch.
«Es ist nur so, dass ich schwul bin», sagte er einfach und so leise, dass sie sich nach vorne beugte, um ihn zu hören. Sie runzelte die Stirn, als er den Stuhl vom Tisch zurückrutschte.
«Und du bist deswegen davongelaufen?», fragte sie.
«Nein!» Zachs Reaktion kam sofort. «Sie haben versucht, es in Ordnung zu bringen, aber es hat nicht geholfen. Ich wollte nicht, dass es hilft. Sie haben mir gesagt, dass ich gehen soll.»
«Aha», war alles, was sie sagte. Er hörte keinen Abscheu in ihrer Stimme, aber sie sprang auch nicht auf und zog den schwulen Obdachlosen in eine Umarmung.
«Danke für die Suppe, Ma’am. Ich weiß Ihre Hilfe, und die ihres Sohnes, zu schätzen.» Er stolperte hoch, Nadeln stachen ihn in seine Beine, und er huschte in den Flur, wo er nur stoppte, weil der Polizist seinen Weg blockierte. Der Mann kam frisch aus der Dusche, mit seinem stacheligen, dunklen Haar und seinen aufmerksamen, braunen Augen. Er sah weniger aus wie ein Polizist und mehr wie ein ganz normaler Mann.
«Was glaubst du, wo du jetzt hin gehst?», fragte er, seinen Kopf schräg gelegt. Zach sah den verwirrten Blick in den Augen des Mannes, und dahinter, tiefer, ein Mitgefühl, dass er seit langer Zeit nicht mehr gesehen hatte.
«Ich gehe, Mr… Officer. Danke für Ihre Hilfe. Es tut mir leid.» Zachs Worte waren zittrig, aber er stellte sicher, dass seine Absicht klar war. Er war entschlossen, zu verschwinden. Sie würden ihn jetzt sowieso nicht mehr unter ihrem Dach haben wollen. Zumindest hatte er eine warme Mahlzeit in seinem Bauch und er würde die Hölle tun und die warmen Klamotten zurückgeben. Er musste nur seine Schuhe finden und dann wäre er verschwunden. Er konnte dem Polizisten vielleicht davonkommen, wenn er genug Vorsprung bekam, weil der Mann barfuß im Flur stand. Zach senkte seinen Blick und schlurfte vorwärts, um vorbei zu kommen, aber er wurde von einem starken Griff an seinem Arm gestoppt.
«Mamma? Hat er etwas getan? Bist du okay?» Ben ignorierte Zach, der zappelte und versuchte, Bens Griff zu lockern. Unruhe und Panik stiegen in ihm auf. Er hatte der Mutter des Polizisten nichts getan, das würde er nicht. Schwach zog er an seinem Arm, aber der verdammte Polizist hatte einen Griff aus Stahl.
«Es sieht so aus, als hätten ihn Zachs Eltern rausgeworfen, weil er schwul ist», erklärte sie. Zach riss sich los, um Abstand zu gewinnen. Bens Gesicht verzog sich plötzlich vor Ärger. Scheiße, dachte Zach sofort, jetzt geht es los, und als der Polizist seine Hand hob, fand sich Zach kauernd vor dem drohenden Schlag. Stattdessen legte der Polizist vorsichtig seine Hand auf Zachs Schulter und schien zu ignorieren, dass Zach sich vor Angst weggedrückt hatte.
«Das passiert oft», sagte der Polizist, sein Gesicht offen, «aber in diesem Haus ist es kein Problem. Mamma hat einen normalo Sohn, der verheiratet ist und zwei Kinder hat, und eine Tochter die immer zwei Partner gleichzeitig hat.» Er pausierte absichtlich, um den ersten Teil einsinken zu lassen. «Dann hat sie noch mich, ihren schwulen Polizisten-Sohn.»
«Oh», war alles, was Zach sagen konnte, während er den Arm, den Ben gepackt hatte, rieb, um den Schmerz zu lindern.
«Dass du schwul bist, ist keines der Dinge, die deinen Aufenthalt bei uns beeinflussen werden. Okay?»
Zach drehte sich um, um Bens Mutter anzusehen, die immer noch am Tisch saß. Sie nickte zustimmend. Es fühlte sich komisch an. Es war eine Art von surrealem Nachmittags-Mädchenfilm. Mit außergewöhnlich hübschen Leuten, die nett waren zu sehr einsamen, jungen Obdachlosen. Er zwinkerte, und seine Augen weiteten sich, als er es realisierte, zu gut, um wahr zu sein, aber trotzdem sehr real.
«Ich gehe ins Bett, Ben. Warum bleibst du nicht noch ein wenig bei Zach und zeigst ihm dann Jamies altes Zimmer. Es sind frische Bettbezüge im Schrank.» Sie stand würdevoll auf, stellte die Schüsseln ins Spülbecken und zog ihren Sohn in eine Umarmung. «Ellie wird um zwei zu Hause sein. Sie hat es versprochen. Halt Ausschau nach ihr für mich.»
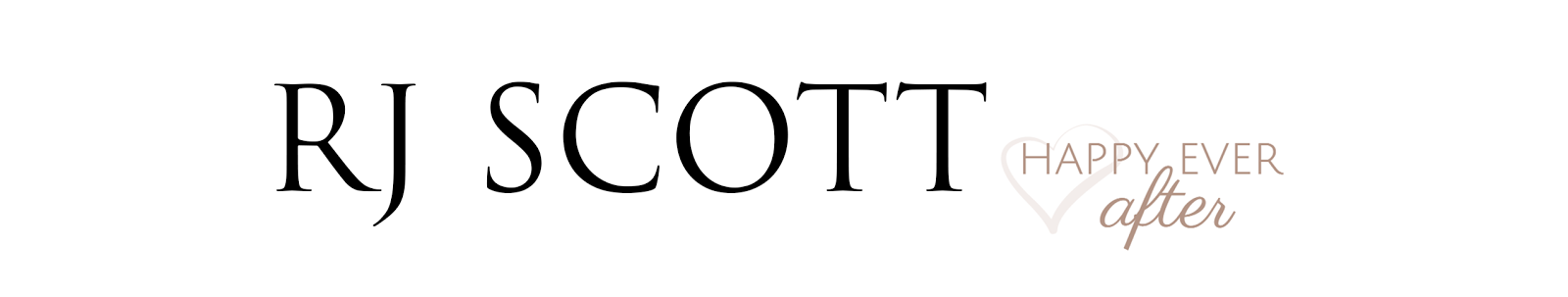


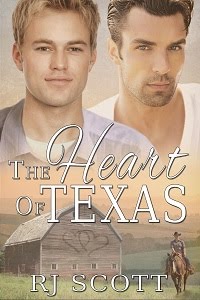
No comments